Gastbeitrag von Anita Steiner, erschienen bei der Schweizer Paraplegiker-Forschung: Die alltäglichen Hürden für Menschen im Rollstuhl kennen wir bestens. Doch was bedeutet es, gleichzeitig queer zu sein?
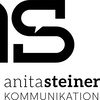 von Anita Steiner – Gästin | 07.10.2025
von Anita Steiner – Gästin | 07.10.2025


Queer und im Rollstuhl – doppelt im Abseits?
Die alltäglichen Hürden für Menschen im Rollstuhl kennen wir bestens. Doch was bedeutet es, gleichzeitig queer zu sein?
- 15 Minuten Lesezeit
- 17. September 2025
Ein Leben im Rollstuhl bedeutet physische und gesellschaftliche Hürden. Queer zu sein heisst, sich ausserhalb heteronormativer Erwartungen zu verorten. Wenn beides zusammentrifft, wird die «Aussenseiterrolle» verstärkt – und Betroffene werden oft an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Oder doch nicht? Wir forschen nach …
Was bedeutet «queer»?
Queer («kwier» ausgesprochen) ist ein englisches Wort, das übersetzt so viel wie «seltsam» oder «komisch» heisst. Es ist eine Sammelbezeichnung für Menschen, deren geschlechtliche Identität und/oder sexuelle Orientierung (wen sie begehren oder wie sie lieben) nicht der zweigeschlechtlichen, cis-geschlechtlichen oder heterosexuellen Norm entspricht. Oft wird in diesem Kontext auch der Begriff LGBTIQ+ verwendet.
Heute benutzen viele nicht heterosexuelle oder cisgeschlechtliche Personen das Wort «queer» als positive Selbstbezeichnung, beispielsweise
- schwule Männer und lesbische Frauen
- bisexuelle oder asexuelle Menschen
- transgeschlechtliche oder intergeschlechtliche Personen
Eine anschauliche Erklärung der Begriffe bietet das SRF-Video «Kurz erklärt: Das bedeutet LGBTIQ+».
Du möchtest mehr wissen? Hier ein Lexikon mit einfachen Erklärungen von queeren Begriffen.
Eine Minderheit innerhalb der Minderheit
Gemäss der Schweizer Fachstelle für behindertengerechtes Bauen sind in der Schweiz rund 40’000 Personen auf einen Rollstuhl angewiesen. Eine Studie von Ipsos zeigt: Bei uns identifizieren sich insgesamt 13 Prozent als LGBT+ – der dritthöchste Wert unter den befragten 30 Ländern. Darunter sind 6 Prozent, die sich als transgender, nichtbinär, genderfluid oder anders als männlich und weiblich bezeichnen – hier liegt die Schweiz sogar auf dem ersten Rang. Ausgehend davon sind über 5’000 Menschen im Rollstuhl und queer.
Vorbilder – que(e)r durch die Schweiz

Ursula Eggli (rechts) gilt in der Schweiz als Wegbereiterin für nicht heterosexuelle Menschen im Rollstuhl. (Bild: Helga Leibundgut: Bern/F 5110-Fc-103 / Anlass: Behinderten Demonstration Bern, 20. Juni 1981 / Quelle: Schweizerisches Sozialarchiv)
Eine Pionierin der Behinderten- sowie Lesben- und Schwulenbewegung war Ursula Eggli (1944-2008). Die Schweizer Schriftstellerin war lesbisch und aufgrund von Muskelschwund seit ihrer Kindheit auf den Rollstuhl angewiesen. 1977 publizierte sie ihr erstes Buch mit dem Titel «Herz im Korsett». Zudem wirkte sie 1979 im mehrfach preisgekrönten Dokumentarfilm «Behinderte Liebe» mit – der erste Schweizer Film, der sich mit der Sexualität von Menschen mit Behinderung befasste.
Welche Organisationen setzen sich für queere Menschen ein?

Der Verein Transgender Network Switzerland TGNS vertritt und vernetzt schweizweit die Interessen von einzelnen trans Menschen, ihren lokalen Gruppierungen und Organisationen. Auf ihrer Webseite findest du eine umfassende Übersicht von Organisationen in der Deutschschweiz, in der Westschweiz und international.
Schweizer Vorbilder aus der heutigen Zeit gibt es viele. Stellvertretend stellen wir euch einige kurz vor:

Taz Keller (27-jährig, aus dem Kanton Aargau, wohnhaft in St. Gallen) bezeichnet sich selbst als «Gesamtpaket», das keiner Norm entspricht. (Bild: Patrick Frauchiger)
Taz Keller ist trans-nonbinär, polyamor und pansexuell. Aufgrund des hypermobilen Ehlers-Danlos-Syndroms kann Taz nur mit dem Rollstuhl am sozialen Leben teilnehmen. Taz studiert Psychologie und Soziologie, ist Teil des queer-feministischen Kunstkollektivs Vulvadrachen Kollektiv und tritt mit UNAPOLOGETIC, einem Tanzstück über Schönheitsnormen und queeres Selbst-Empowerment, unter anderem am Lila-Queer-Festival auf.
Taz engagiert sich – «ADHS sei Dank», wie Taz selbst sagt – vielseitig und auch ausserhalb der queeren Community, zum Beispiel bei der Ozeanschutzorganisation Sea Shepherd. In diesem Instagram-Video spricht Taz am feministischen Streik St. Gallen über Behinderung und das Privileg der Sichtbarkeit.
«Was meine queeren Identitäten und meine Erkrankung gemeinsam haben ist, dass ich beides früher normalisiert habe. Ich schloss von mir auf die Gesamtheit. So dachte ich zum Beispiel, jeder Mensch hätte immer Rückenschmerzen und alle wüssten mit den Begriffen Mann und Frau wenig anzufangen. Erst durch Gespräche entdeckte ich, dass es nicht so ist. Mit meiner Diagnose und meinen Labels fand ich dafür einen Namen – und zu mir selbst.»
Taz Keller

Erst bei seiner Kandidatur als Politiker für die Sozialdemokratische Partei (SP) Luzern outete sich Roger Seger als homosexuell – rückblickend seine beste Entscheidung.
Aufgrund einer Nervenerkrankung ist Roger Seger mehrheitlich auf den Rollstuhl angewiesen. Geboren in Luzern und in wohnhaft in Würenlos AG, lebt er seit 33 Jahren mit seinem Lebensgefährten zusammen. Nach seinem politischen Engagement für die Inklusionsinitiative setzt sich Roger Seger leidenschaftlich in der queeren Community ein, unter anderem für Pink Cross. Zudem engagiert er sich ehrenamtlich als Sterbebegleiter.
«Als schwuler Rollstuhlfahrer mit Colitis ulcerosa und einem Dünndarmstoma vertrete ich gleich vier Minderheiten – die sich meiner Ansicht nach gar nicht so sehr von der Mehrheit unterscheiden. Wir alle wollen integriert sein und uns aktiv am gesellschaftlichen Leben beteiligen.»
Roger Seger

Pink Cross ist die Dachorganisation der schwulen und bisexuellen Männer* in der Schweiz. Der Verein vertritt die Interessen der gleichgeschlechtlichen Liebe in Politik und Gesellschaft, bietet Beratungen an und vernetzt die Schweizer LGBTIQ+-Community national und international.
*Alle Personen, die sich dem männlichen Geschlecht zugehörig fühlen, sowie Personen anderer Geschlechter, die sich mit den Anliegen von Pink Cross identifizieren.

Selma Mosimann beweist: Wer seine Bedürfnisse ernst nimmt und offen ist, kommt bei sich selbst an – auch auf Umwegen.
Selma Mosimann ist mit Cerebralparese geboren. Die 36-jährige St. Gallerin teilt ihre Erfahrungen als lesbische Rollstuhlfahrerin in zahlreichen Organisationen: seit 2022 im Vorstand von Netzwerk Avanti, als Mitglied der Lesbenorganisation Schweiz LOS und in der Vereinigung Celebral Schweiz, insbesondere im Netzwerk CerAgility und in Weiterbildungen von CerAdult. Für die St. Gallen Pride berät sie das OK-Team zu Barrierefreiheit und initiierte das Übersetzen der Reden in Gebärdensprache.
«Als lesbische Frau im Rollstuhl möchte ich die queere Community und die Behindertencommunity sichtbar machen und gegenseitig verbinden. Denn ich finde, beide Welten dürfen und müssen zusammen funktionieren.»
Selma Mosimann

Als nationaler Dachverband für Lesben, Bisexuelle und queere Frauen setzt sich die Lesbenorganisation Schweiz LOS dafür ein, dass das Leben von Betroffenen besser wird. Sie unterstützt Mitgruppen und Mitglieder, sensibilisiert die Öffentlichkeit für ihre Anliegen, ist Ansprechpartnerin für Fragen und leistet politische Arbeit.

Iwan (links) als wichtigste Bezugsperson und der quirlige Hund Sämi schenken Franz Rullo Lebensfreude und -energie.

Queer und im Rollstuhl – doppelt im Abseits?
Die alltäglichen Hürden für Menschen im Rollstuhl kennen wir bestens. Doch was bedeutet es, gleichzeitig queer zu sein?
- 15 Minuten Lesezeit
- 17. September 2025
Ein Leben im Rollstuhl bedeutet physische und gesellschaftliche Hürden. Queer zu sein heisst, sich ausserhalb heteronormativer Erwartungen zu verorten. Wenn beides zusammentrifft, wird die «Aussenseiterrolle» verstärkt – und Betroffene werden oft an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Oder doch nicht? Wir forschen nach …
Was bedeutet «queer»?
Queer («kwier» ausgesprochen) ist ein englisches Wort, das übersetzt so viel wie «seltsam» oder «komisch» heisst. Es ist eine Sammelbezeichnung für Menschen, deren geschlechtliche Identität und/oder sexuelle Orientierung (wen sie begehren oder wie sie lieben) nicht der zweigeschlechtlichen, cis-geschlechtlichen oder heterosexuellen Norm entspricht. Oft wird in diesem Kontext auch der Begriff LGBTIQ+ verwendet.
Heute benutzen viele nicht heterosexuelle oder cisgeschlechtliche Personen das Wort «queer» als positive Selbstbezeichnung, beispielsweise
- schwule Männer und lesbische Frauen
- bisexuelle oder asexuelle Menschen
- transgeschlechtliche oder intergeschlechtliche Personen
Eine anschauliche Erklärung der Begriffe bietet das SRF-Video «Kurz erklärt: Das bedeutet LGBTIQ+».
Du möchtest mehr wissen? Hier ein Lexikon mit einfachen Erklärungen von queeren Begriffen.
Eine Minderheit innerhalb der Minderheit
Gemäss der Schweizer Fachstelle für behindertengerechtes Bauen sind in der Schweiz rund 40’000 Personen auf einen Rollstuhl angewiesen. Eine Studie von Ipsos zeigt: Bei uns identifizieren sich insgesamt 13 Prozent als LGBT+ – der dritthöchste Wert unter den befragten 30 Ländern. Darunter sind 6 Prozent, die sich als transgender, nichtbinär, genderfluid oder anders als männlich und weiblich bezeichnen – hier liegt die Schweiz sogar auf dem ersten Rang. Ausgehend davon sind über 5’000 Menschen im Rollstuhl und queer.
Vorbilder – que(e)r durch die Schweiz

Ursula Eggli (rechts) gilt in der Schweiz als Wegbereiterin für nicht heterosexuelle Menschen im Rollstuhl. (Bild: Helga Leibundgut: Bern/F 5110-Fc-103 / Anlass: Behinderten Demonstration Bern, 20. Juni 1981 / Quelle: Schweizerisches Sozialarchiv)
Eine Pionierin der Behinderten- sowie Lesben- und Schwulenbewegung war Ursula Eggli (1944-2008). Die Schweizer Schriftstellerin war lesbisch und aufgrund von Muskelschwund seit ihrer Kindheit auf den Rollstuhl angewiesen. 1977 publizierte sie ihr erstes Buch mit dem Titel «Herz im Korsett». Zudem wirkte sie 1979 im mehrfach preisgekrönten Dokumentarfilm «Behinderte Liebe» mit – der erste Schweizer Film, der sich mit der Sexualität von Menschen mit Behinderung befasste.
Welche Organisationen setzen sich für queere Menschen ein?

Der Verein Transgender Network Switzerland TGNS vertritt und vernetzt schweizweit die Interessen von einzelnen trans Menschen, ihren lokalen Gruppierungen und Organisationen. Auf ihrer Webseite findest du eine umfassende Übersicht von Organisationen in der Deutschschweiz, in der Westschweiz und international.
Schweizer Vorbilder aus der heutigen Zeit gibt es viele. Stellvertretend stellen wir euch einige kurz vor:

Taz Keller (27-jährig, aus dem Kanton Aargau, wohnhaft in St. Gallen) bezeichnet sich selbst als «Gesamtpaket», das keiner Norm entspricht. (Bild: Patrick Frauchiger)
Taz Keller ist trans-nonbinär, polyamor und pansexuell. Aufgrund des hypermobilen Ehlers-Danlos-Syndroms kann Taz nur mit dem Rollstuhl am sozialen Leben teilnehmen. Taz studiert Psychologie und Soziologie, ist Teil des queer-feministischen Kunstkollektivs Vulvadrachen Kollektiv und tritt mit UNAPOLOGETIC, einem Tanzstück über Schönheitsnormen und queeres Selbst-Empowerment, unter anderem am Lila-Queer-Festival auf.
Taz engagiert sich – «ADHS sei Dank», wie Taz selbst sagt – vielseitig und auch ausserhalb der queeren Community, zum Beispiel bei der Ozeanschutzorganisation Sea Shepherd. In diesem Instagram-Video spricht Taz am feministischen Streik St. Gallen über Behinderung und das Privileg der Sichtbarkeit.
«Was meine queeren Identitäten und meine Erkrankung gemeinsam haben ist, dass ich beides früher normalisiert habe. Ich schloss von mir auf die Gesamtheit. So dachte ich zum Beispiel, jeder Mensch hätte immer Rückenschmerzen und alle wüssten mit den Begriffen Mann und Frau wenig anzufangen. Erst durch Gespräche entdeckte ich, dass es nicht so ist. Mit meiner Diagnose und meinen Labels fand ich dafür einen Namen – und zu mir selbst.»
Taz Keller

Erst bei seiner Kandidatur als Politiker für die Sozialdemokratische Partei (SP) Luzern outete sich Roger Seger als homosexuell – rückblickend seine beste Entscheidung.
Aufgrund einer Nervenerkrankung ist Roger Seger mehrheitlich auf den Rollstuhl angewiesen. Geboren in Luzern und in wohnhaft in Würenlos AG, lebt er seit 33 Jahren mit seinem Lebensgefährten zusammen. Nach seinem politischen Engagement für die Inklusionsinitiative setzt sich Roger Seger leidenschaftlich in der queeren Community ein, unter anderem für Pink Cross. Zudem engagiert er sich ehrenamtlich als Sterbebegleiter.
«Als schwuler Rollstuhlfahrer mit Colitis ulcerosa und einem Dünndarmstoma vertrete ich gleich vier Minderheiten – die sich meiner Ansicht nach gar nicht so sehr von der Mehrheit unterscheiden. Wir alle wollen integriert sein und uns aktiv am gesellschaftlichen Leben beteiligen.»
Roger Seger

Pink Cross ist die Dachorganisation der schwulen und bisexuellen Männer* in der Schweiz. Der Verein vertritt die Interessen der gleichgeschlechtlichen Liebe in Politik und Gesellschaft, bietet Beratungen an und vernetzt die Schweizer LGBTIQ+-Community national und international.
*Alle Personen, die sich dem männlichen Geschlecht zugehörig fühlen, sowie Personen anderer Geschlechter, die sich mit den Anliegen von Pink Cross identifizieren.

Selma Mosimann beweist: Wer seine Bedürfnisse ernst nimmt und offen ist, kommt bei sich selbst an – auch auf Umwegen.
Selma Mosimann ist mit Cerebralparese geboren. Die 36-jährige St. Gallerin teilt ihre Erfahrungen als lesbische Rollstuhlfahrerin in zahlreichen Organisationen: seit 2022 im Vorstand von Netzwerk Avanti, als Mitglied der Lesbenorganisation Schweiz LOS und in der Vereinigung Celebral Schweiz, insbesondere im Netzwerk CerAgility und in Weiterbildungen von CerAdult. Für die St. Gallen Pride berät sie das OK-Team zu Barrierefreiheit und initiierte das Übersetzen der Reden in Gebärdensprache.
«Als lesbische Frau im Rollstuhl möchte ich die queere Community und die Behindertencommunity sichtbar machen und gegenseitig verbinden. Denn ich finde, beide Welten dürfen und müssen zusammen funktionieren.»
Selma Mosimann

Als nationaler Dachverband für Lesben, Bisexuelle und queere Frauen setzt sich die Lesbenorganisation Schweiz LOS dafür ein, dass das Leben von Betroffenen besser wird. Sie unterstützt Mitgruppen und Mitglieder, sensibilisiert die Öffentlichkeit für ihre Anliegen, ist Ansprechpartnerin für Fragen und leistet politische Arbeit.
Die Lebensgeschichte von Franz Rullo ist unglaublich: Verkehrstod der Mutter, Kindheit bei der Homosexualität verabscheuenden Tante, Hirnblutung, Teillähmung nach Hirntumor-OP, Barrett-Ösophagus, komplette Querschnittlähmung aufgrund seiner Hirnläsion, dazu Schwindelanfälle, Sehstörungen, beeinträchtigte Schluck- und Blasenfunktion etc. Doch Aufgeben ist keine Option. Als aktives Mitglied dieser Online-Community teilt er seine Erfahrungen und motiviert dadurch andere.
«Wir existieren zwischen Welten – queer, gelähmt, aber nicht gebrochen. Unsere Körper tragen Geschichten, unsere Liebe sprengt Normen. Eine Gesellschaft, die uns übersieht, verpasst ihre eigene Menschlichkeit.»
Franz Rullo

Avanti ist das Netzwerk von und für Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nicht-binäre, trans und agender Personen, die mit einer Behinderung oder chronischen Krankheit leben. Ziel ist die Gleichstellung und die diskriminierungsfreie gesellschaftliche Teilhabe aller FLINTA, ungeachtet ihres Alters sowie der Art und Schwere ihrer Beeinträchtigung.

Vorurteilen gegenüber «nicht der Norm entsprechenden» Menschen begegnet Edwin Ramirez mit tiefgründigem Humor, öffentlichkeitswirksamen Auftritten und starkem Engagement in der Szene.
Edwin Ramirez ist nonbinär, neurodivergent, aufgrund von Zerebralparese im Rollstuhl und hat afro-dominikanische Wurzeln. Bekannt wurde Edwin als Stand-Up-Comedian, 2020 gründete Edwin als Performance Artist mit Nina Mühlemann das queer-crippe Theaterkollektiv Criptonite. Als Aktivist*in und Co-Leitung des Vereins Netzwerk Avanti verbindet Edwin anti-rassistische, anti-ableistische und queere Kämpfe und spricht auch regelmässig in Interviews und Podcasts darüber.
«Es stört mich unheimlich, dass immer so getan wird, als sei Queersein etwas ganz Neues. Dabei gibt es Queers schon so lange, wie es die Menschheit gibt.»
Edwin Ramirez
Was bedeutet «crip»?
Früher war «crip» ein abwertender Begriff oder sogar ein Schimpfwort, abgeleitet vom englischen Wort «cripple» (Krüppel). In den letzten Jahrzehnten haben sich Menschen mit Behinderung das Wort zurückerobert. Sie wollen sich damit von der traditionellen und oft diskriminierenden Sichtweise abgrenzen. Aber Vorsicht: Obwohl die selbstgewählte Bezeichnung von vielen als positiv und befreiend empfunden wird, ist «crip» für manche noch immer negativ assoziiert.
Queere Role-models auf der ganzen Welt
Marissa Bode ist eine queere US-amerikanische Schauspielerin. Als erste querschnittgelähmte Schauspielerin verkörperte sie Nessarose Thropp in den Musicalfilmen «Wicked» (2024) und «Wicked: For Good» (2025) – eine Rolle, die auch in der Realität für Veränderungen sorgte: barrierefreies Filmset und Spielfigur von Mattel in Kinderzimmern.
Wicked's Marissa Bode and Ethan Slater on the Very Queer World of Oz
Die niederländische Para-Rollstuhlbasketballspielerin Bo Kramer lebt offen mit ihrer Homosexualität. Sie gewann Bronze bei den Paralympischen Sommerspielen 2016 und Gold bei den Paralympischen Sommerspielen 2020 und 2024.
Die queere US-amerikanische Psychologin und Aktivistin Danielle Ann Sheypuk ist bekannt als Ms. Wheelchair NY 2012 und als erste Rollstuhlfahrerin auf der New York Fashion Week. Sie bezeichnet sich selbst als «Sexpertin» rund um Themen wie Dating, Beziehungen und Sexualität von Menschen mit Behinderungen.
Andrea Lausell ist eine queere Latina mit Spina bifida. In diesem Artikel erzählt sie, wie sich ihre Freundschaften und ihr Selbstwertgefühl durch den Rollstuhl veränderten.
Die pansexuelle Melody Powell aus England teilt ihre Erfahrungen als queere Person mit Behinderung und kämpft für die Rechte von Menschen mit Behinderung und für LGBTIQ+-Rechte. Sie arbeitet mit der Alliance for Inclusive Education ALLFIE zusammen, um und das britische Bildungssystem und seine Schulen inklusiver zu machen.
Our Stories - An Interview with Melody Powell
Sandy Ho ist eine queere asiatisch-amerikanische Rollstuhlfahrerin und schwerhörig. Sie ist Gründerin des Disability and Intersectionality Summit und Co-Partnerin der Kampagne «Access Is Love». 2015 wurde sie vom Weissen Haus als «Champion of Change» ausgezeichnet. Derzeit leitet sie den Disability Inclusion Fund bei Borealis Philanthropy.
Die YouTuberin, Künstlerin und Aktivistin Annie Segarra, auch bekannt als Annie Elainey, setzt sich für Barrierefreiheit, Body Positivity und die mediale Darstellung marginalisierter Gemeinschaften ein. Sie ist queer, lateinamerikanisch und im Rollstuhl.
Die US-amerikanische Schauspielerin Jillian Mercado ist aufgrund einer Muskeldystrophie im Rollstuhl. Das Model mit dominikanischen Wurzeln stellt die Schönheitsideale in Frage und kämpft gegen die mangelnde Repräsentation von Menschen mit Behinderungen in der Modebranche und deren anhaltende Stigmatisierung. Ihr Coming-Out als queere Person publizierte sie auf Instagram.
… viele weitere Persönlichkeiten ergänzen die Liste.

ParaPride ist eine englische Empowerment-Organisation, die sich für die Sichtbarkeit, Aufklärung und das Bewusstsein von LGBTQ+-Menschen mit Behinderung einsetzt. Ihre Mission ist es, die mangelnde Inklusion von Menschen mit Behinderungen innerhalb der LGBTQ+-Community zu bekämpfen, barrierefreiere queere Räume zu schaffen und die Wertschätzung von unterschiedlichen Körpern zu fördern.
Que(e)rschnittgelähmt: mehrfaches Coming-out
Das Öffentlichmachen der sexuellen Orientierung und/oder Geschlechtsidentität ist herausfordernd. Aus Angst vor – noch stärkerer – Ausgrenzung erleben nicht-heterosexuelle Menschen mit Beeinträchtigung ihr Coming-Out wesentlich später als Menschen ohne Behinderung.
Dies bestätigte im Interview mit EnableMe auch Thomas Rattay, damals Referent für Jugendliche mit Behinderung beim deutschen queeren Jugendnetzwerk Lambda: «In der Regel findet bei Jugendlichen ohne Behinderung das Coming-out zwischen 15 und 17 Jahren statt. Heranwachsende mit Behinderung outen sich meist erst mit Anfang, Mitte 20.»
«Ich war acht Jahre mit einem Mann zusammen – bis zu meiner ‹zweiten Pubertät›: Nach einer langen Findungszeit habe ich mich 2016 als lesbisch geoutet. Der Austausch in Frauengruppen und Organisationen hat mir dabei sehr geholfen und gezeigt: Ich bin nicht allein.»
Selma Mosimann
Roger Seger offenbarte seine Homosexualität mit 18 Jahren lediglich seiner Familie und im engsten Freundeskreis. Erst 2018 im Zusammenhang mit seiner Kandidatur für den Gemeinderat Schlieren outete er sich öffentlich – die Wählerinnen und Wähler sollten wissen, mit wem sie es zu tun haben und für welche Themen er sich engagiere. Dass sich sein langjähriger Partner aufgrund seiner persönlichen Situation und Stellung nicht outen will, ist für Roger absolut in Ordnung.
«Rückblickend war das Coming-Out meine beste Entscheidung. Früher hat mich das Erfinden von Geschichten viel Energie gekostet – heute bin ich völlig befreit. Ich finde, Menschen sollten mutiger werden und offen zu dem stehen, was zu ihnen gehört.»
Roger Seger
Änderung des Geschlechts im Personenstandsregister
Seit dem 1. Januar 2022 ist die Änderung des Geschlechtseintrags in der Schweiz durch eine einfache Erklärung beim Zivilstandsamt möglich. Hierzu sind weder medizinische Nachweise noch ein gerichtliches Verfahren erforderlich. Die Erklärung kann mit oder ohne Namensänderung erfolgen und kostet 75 Franken.
Ehe für alle
Seit dem 1. Juli 2022 können in der Schweiz zwei Personen gleichen Geschlechts heiraten. Bereits eingetragene Partnerschaften können weiterbestehen oder in eine Ehe umgewandelt werden.
Auch Taz Keller outete sich erst mit 20 Jahren. Damals bezeichnete Taz sich selbst als «der coole cis-iater» – bis Taz das erste Mal mit der besten Freundin schlief. Ein Schlüsselereignis, das Taz zum wahren Ich führte. «Ich verliebe mich aufgrund des Charakters in einen Menschen oder fühle mich sexuell von ihm angezogen, unabhängig von Geschlecht oder Genderidentität.»
«Ich wurde davon beeinflusst, dass viele meinen, man wolle nur Aufmerksamkeit. Dabei sind die Reaktionen nach einem Outing meist wenig positiv. Zu sich selbst zu finden und sich einzugestehen, dass man anders ist, ist zwar anstrengend, aber megaschön. Wenn nötig, muss man sich von Menschen distanzieren, die dies nicht akzeptieren. Dafür ist man in der ‹chosen family› willkommen.»
Taz Keller
Tipp: Die SRF-Sendung KREUZ UND QUEER hilft der Schweiz beim grossen Coming-Out.
Zwischen Ableismus und Queerfeindlichkeit
Behinderung und Sexualität schliessen sich nicht aus. So weit, so gut. Doch wenn ein Grossteil der Gesellschaft noch immer davon ausgeht, dass Menschen im Rollstuhl asexuell, infantil oder «bedürftig» seien, dann ist es kein Wunder, dass queere Menschen im Rollstuhl oft ignoriert oder fetischisiert werden.
«Meistens werde ich von fremden Leuten ausserhalb der Community auf den Rollstuhl, oft auch auf mein Lesbisch-Sein reduziert – dabei möchte ich einfach nur Selma sein. Wenn andere in der Badi meine behaarten Beine sehen, kann ich ihre Gedanken erahnen: Sie meinen, ich sei nicht fähig, mich zu rasieren. Sorry Leute, das ist eine bewusste Entscheidung!»
Selma Mosimann
Queere Rollstuhlnutzerinnen und -nutzer berichten oft von einer Mehrfachdiskriminierung. So haben sie das Gefühl, sich in jeder neuen Situation doppelt erklären zu müssen: Weshalb sie im Rollstuhl sind und warum ihre sexuelle Identität nicht der Norm entspricht.
Queer and Disabled Pt. 1 | Misconceptions [CC]
Dabei sind offensichtliche Diskriminierungen – durch Akte der Ausgrenzung und des Hasses – nur die Spitze des Eisbergs. Weniger sichtbare, aber ebenfalls schmerzhafte Arten von Diskriminierung sind zum Beispiel:
- Unsichtbarkeit oder Ignoranz: Nichtbeachtung und Absprechen von Sexualität, Ausgrenzung durch fehlende Barrierefreiheit, Abbruch von Dates nach dem Outing
- Neugier oder Fetischisierung: übergriffige oder sexualisierte Fragen, Voyeurismus, sexuelle Objektifizierung («exotische Tabu-Fantasie»)
- Mitleid und Bevormundung: Deutung der Behinderung als «tragisches Schicksal» und Queerness als doppelte Belastung, Ansehen der Person als minderwertig, Entmündigung
- Diskriminierung durch mehrfache Marginalisierung: Ableismus und Queerfeindlichkeit aufgrund von Unwissen über queere und körperlich diverse Lebensrealitäten
«Was wir nicht kennen, das verstehen wir nicht. Die Unsicherheit und somit auch der Widerstand hängen stark damit zusammen, dass die entsprechende Schulung respektive die Aufklärung fehlen.»
Taz Keller
Sogar innerhalb der queeren Szene erleben manche Betroffene Ableismus: Clubs sind nicht rollstuhlgängig, Dating-Apps filtern Behinderungen automatisch aus und Pride-Veranstaltungen sind nicht immer inklusiv gestaltet. Die Rede von Nina Mühlemann und Suna Kircali am CSD Zürich verdeutlicht dies eindrucksvoll.
Queer und Behinderung – doppelt ausgeschlossen? 🌈👨🦽 KÜBRA spricht mit ED GREVE (Teil 1)
Das «Bauchgefühl», dass queere Menschen mit Behinderung doppelt stigmatisiert werden, bestätigt diese Forschungsarbeit. Betroffene werden häufiger diskriminiert, unter anderem in den Bereichen Bildung, Arbeit, Finanzen, Gesundheit und intime Beziehungen.

Was ist das Schweizer LGBTIQ+ Panel?
Diese Verlaufsstudie von Dr. Tabea Hässler (Universität Zürich) und Dr. Léïla Eisner (Universität Zürich) untersucht seit 2019 jährlich die Situation von LGBTIQ+-Personen in der Schweiz. Die Sozialpsychologinnen setzen sich wissenschaftlich und gesellschaftlich für mehr Sichtbarkeit und Gleichstellung ein.
Glücklicherweise kommt Bewegung in die Thematik. Projekte wie «Queer & Behinderung – Ja, uns gibt es!» der Initiative Zukunft Inklusion fördern die Sichtbarkeit betroffener Menschen. Das Zürcher Pride-HAZ-Magazin rückte in einer Ausgabe queere Menschen mit Behinderung in den Mittelpunkt. Und auf politischer Ebene werden queere Menschen lauter, unter anderem dank der Autorin und Nationalrätin Anna Rosenwasser.
«Ich bin positiv überrascht vom schönen Umgang im queeren Umfeld. Es wird mir Hilfe angeboten, aber niemals aufdringlich. Und ich bin erstaunt, wie direkt die Fragen an mich sind – das finde ich grossartig!»
Roger Seger
Werden queere Menschen in der Schweiz diskriminiert?
Eine Studie aus dem Jahr 2024 zeigte, dass die Bevölkerung gegenüber der LGBTIQ+-Gemeinschaft grundsätzlich offen und wohlgesinnt ist. Gemäss einer noch aktuelleren, repräsentativen Bevölkerungsbefragung vom April 2025 stehen 83 Prozent der Schweizer Bevölkerung hinter der LGBTIQ+-Community. Diese Mehrheit will Gleichstellung, Schutz vor Diskriminierung und ein Ende queerfeindlicher Angriffe.
Dennoch beobachten LGBTIQ+-Personen eine Zunahme von Intoleranz und Gewalt aufgrund politischer Stimmungsmache, die sich insbesondere gegen trans und intergeschlechtliche Menschen richtet. Hinter den verbalen oder physischen Übergriffen stecken Vorurteile oder falsche Vorstellungen.
Laut Hate Crime Bericht vom Mai 2025 sind Betroffene beinahe täglich Gewalt und Diskriminierung ausgesetzt. Besonders betroffen sind mehrfach marginalisierte Menschen – zum Beispiel, wenn sie queer und behindert sind.
«Als 19-Jähriger wurden ich und meine Freunde vor dem Regenbogenhaus Luzern angegriffen. Über zehn Leute schlugen auf uns ein und traten uns, wir waren völlig wehrlos. Zum Glück kam uns ein kräftiger Mann zu Hilfe.»
Roger Seger
Was tun bei einem Übergriff?
- Verlasse den Gefahrenbereich, sobald es die Situation zulässt.
- Hole Hilfe und organisiere medizinische Versorgung, falls nötig.
- Verständige die Polizei unter der Notrufnummer 117.
- Bitte Zeugen, vor Ort zu bleiben, und sammle Beweise.
- Merke dir den/die Täter*in und die Fluchtrichtung.
- Melde den Vorfall mittels Meldeformular an die LGBTIQ-Helpline.
Seit 2020 haben sich die Meldungen verfünffacht. Im Jahr 2024 wurden 309 «Hate Crimes» (Hassverbrechen) gegenüber LGBTIQ+-Menschen gemeldet – fast sechs pro Woche. Die Vorfälle umfassen körperliche Übergriffe, verbale Gewalt – u. a. Mobbing und Cybermobbing –, sexuelle Belästigungen sowie Ignoranz und Diskriminierung im Arbeitsumfeld, im Kontakt mit öffentlichen Institutionen und im Gesundheitswesen.
Hass gegen LGBTQ+ – Von Diskriminierung und Widerstand | Doku | SRF Dok

Die queeren Berater*innen der LGBTIQ-Helpline unterstützen dich kostenlos und vertraulich bei Fragen zu deiner sexuellen Orientierung, Geschlechtsidentität oder Intergeschlechtlichkeit: von Montag bis Freitag, 19 bis 21 Uhr per Chat und telefonisch unter 0800 133 133 sowie jederzeit per E-Mail. Hate Crimes können via Meldeformular gemeldet werden.
Die mediale (Un-)Sichtbarkeit
Menschen im Rollstuhl sind in den Medien stark unterrepräsentiert – queere Menschen im Rollstuhl erst recht. Andere, besonders Jugendliche, benötigen Identifikationsmöglichkeiten, um mit ihrer eigenen Situation umgehen zu können.
Queer and Disabled Pt. 2 | Representation and Accessibility [CC]
Die gute Nachricht: Die Medien werden «farbenfroher». Die ZDF-Doku «einfach Mensch» über die nichtbinäre Dragqueen im Rollstuhl Mieze McCripple beleuchtet die doppelten Barrieren für queere Menschen mit Behinderung.
Spaniens mehrfach ausgezeichnete Doku «Yes, We Fuck!» dokumentiert sechs Menschen mit «funktionaler Diversität» und erklärt offen und explizit, dass auch Menschen mit Behinderung sexuelle Lust empfinden können und aktiv leben.
Die Dokumentation «Picture This» von Jari Osborne porträtiert Andrew Gurza, der sich als «queer cripple» bezeichnet. Andrew erzählt von seinem Coming‑out, Selbstwahrnehmung und Aktivismus.
Picture This
«Mich stört nicht, dass ich weiblich aussehe, sondern wie mein Körper von anderen gesehen und ‹schubladisiert› wird. Wenn das Transsein akzeptiert wird, werden mehr zu ihrem Anderssein stehen können – ähnlich wie damals bei den Linkshändern. Ich finde, man muss nicht erklären können, wie Lichtgeschwindigkeit funktioniert, aber man kann es trotzdem akzeptieren.»
Taz Keller
Fazit: Die Regenbogenbewegung kommt ins Rollen
Auch wenn sich immer mehr queere Menschen im Rollstuhl outen oder an Prides etc. teilnehmen: Sie sind in der Schweiz von vielfacher und oft übersehener Diskriminierung betroffen – wegen ihrer Queerness wie auch ihrer Behinderung. Betroffene kämpfen aktiv für mehr Sichtbarkeit, sexuelle Selbstbestimmung und barrierefreie Zugänge. Konkrete Zahlen fehlen, doch die Community wird sichtbarer und lauter – und sie fordert politische und gesellschaftliche Veränderungen.
Veranstaltungen für queere Menschen in der Schweiz
- Der Pride- und Event-Kalender von gay.ch bietet eine Übersicht über alle grösseren queeren Events und Prides in der Schweiz für das laufende Jahr.
- Pinkcross als grösste LGBTIQ+-Dachorganisation hat eine Agenda mit Queer-Veranstaltungen, Konferenzen, Stammtischen und Partys.
- Die Milchjugend führt einen Kalender mit vielen jugend- und community-orientierten Treffpunkten und Events in Deutschschweizer Städten.
- QueerAlternBern, Du-bist-du, Queer Lozärn und Eventfrog führen ebenfalls umfangreiche Übersichten zu lokalen Events, Treffs, Prides und queeren Partys.